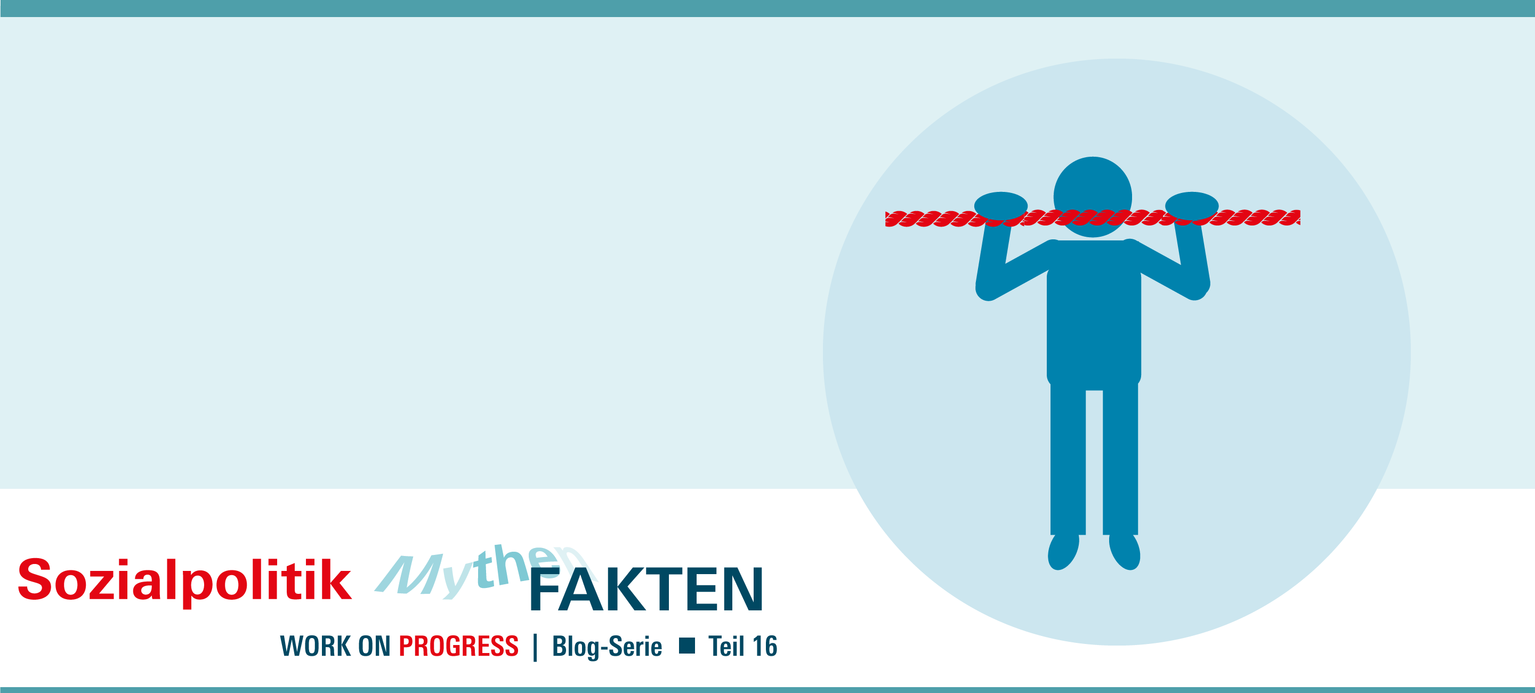
Quelle: WSI
Magnus Brosig, 14.04.2025: Faire Haltelinie: Warum ein dauerhaft stabiles Rentenniveau sinnvoll und gerecht ist
Stabile Rente zulasten der Jüngeren? Diese Behauptung ist weit verbreitet und doch falsch: Ein dauerhaft ordentliches Nettorentenniveau trifft auf breite Zustimmung und wäre tatsächlich hilfreich und generationengerecht.
Würden im Versicherungsleben einmal erworbene Rentenansprüche nominal („in Euro“) ausgewiesen und unverändert bleiben, käme es in der oft noch langen Zeit bis zum Rentenbeginn und im Rentenbezug zu massiven Entwertungen. An einem Beispiel illustriert: Unterstellt man einen zum 45. Geburtstag erreichten Rentenanspruch von 1.000 Euro und eine jährliche Inflationsrate von zwei Prozent, so müsste dieser Teil der dann laufenden Rente zum 85. Geburtstag bei etwa 2.200 Euro liegen, um seine ursprüngliche Kaufkraft zu erhalten. Bei Nichtanpassung käme es umgekehrt zu einer Entwertung von über 50 Prozent. Noch stärker wäre der Effekt, wenn man die Rente mit den Einkommen der Beschäftigten vergleicht, da sich Löhne im jahrelangen Mittel tendenziell besser entwickeln als die Inflation. Für echte Teilhabe und Anerkennung von Lebensleistungen in einer dynamischen Volkswirtschaft ist es deshalb notwendig, Rentenansprüche und laufende Renten systematisch und angemessen anzupassen.
Von Brutto- zu Nettoanpassung
Diese „Valorisierung“ (von Ansprüchen) bzw. „Indexierung“ (von Renten) wird in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) nach einem einheitlichen Verfahren vorgenommen, bei dem die individuell erreichten Entgeltpunkte jeweils zur Jahresmitte mit einem neuen Gegenwert versehen werden. In der Regel werden sie höher bewertet, in schlechten Zeiten kann es auch zu Nullrunden kommen. Nominale Kürzungen sind allerdings ausgeschlossen. Der in Euro ausgedrückte Wert eines Entgeltpunkts – der „aktuelle Rentenwert“ – wird dabei nach einem komplizierten Modell rund um die Rentenanpassungsformel angepasst, das im Laufe der Jahrzehnte erheblich geändert worden ist (siehe dazu Steffen 2002, 2013 und 2024): Nach der großen Rentenreform von 1957 war zunächst eine Rentenanpassung entsprechend der Bruttolohnentwicklung vorgesehen, wobei die Anpassungen wegen vielfacher Eingriffe des Gesetzgebers letztlich allerdings merklich dahinter zurückblieben. Durch das „Rentenreformgesetz 1992“ wurde das System diesbezüglich „ehrlicher“, weil fortan systematisch nach Lohnentwicklung unter Berücksichtigung der anfallenden Abgaben angepasst wurde (Nettolohnprinzip). Bemerkenswert ist, dass diese Rentenreform die letzte große Änderung war, die von der jahrzehntelangen „großen Rentenkoalition“ aus Unionsparteien, SPD und FDP getragen wurde. Gemeinsames Ziel war, dass das Anpassungssystem einen fairen Ausgleich zwischen jeweils Beschäftigten und Rentenbeziehenden unter Wahrung eines dauerhaft akzeptablen gesetzlichen Versorgungsniveaus gewährleistet und Beitragssatzsteigerungen entsprechend auf die Einkommen beide Seiten durchschlagen. In diesem Sinne ließen sich die Abgeordneten im Bericht des zuständigen Bundestagsausschusses wie folgt zitieren:
„Durch die vorgesehene Anpassung der Renten, die sich nicht mehr nur nach der Entwicklung der Bruttolöhne, sondern auch unter Berücksichtigung der Belastungsveränderungen bei Steuern und Beiträgen vollziehen solle, werde gewährleistet, daß sich ergebende Lasten insoweit gemeinsam von Beitragszahlern und Rentenbeziehern getragen würden. Die aus dem Grundsatz der gleichgewichtigen Entwicklung von verfügbaren Löhnen und Renten sich ergebende Stabilisierung des Netto-Rentenniveaus sei als richtig anzusehen, weil weder den Beitragszahlern noch den Rentnern eine ständige Absenkung ihres Netto-Einkommensniveaus zumutbar wäre.“ (BT-Drs. 11/5530, S. 13)
Grundsätzlich und vereinfacht dargestellt wird das dort erwähnte Rentenniveau seit längerer Zeit als Verhältnis einer Rente nach 45 Jahren des stetigen Durchschnittsverdienstes („Standardrente“) zum gegenwärtigen Durchschnittslohn definiert. Es bildet damit die strukturelle Fähigkeit der Rentenversicherung zum Lohnersatz ab. Je nach Definition von Nenner und Zähler kann das Niveau brutto, netto (wie ersichtlich im Kontext der damaligen Reform verwendet, wobei etwa 70 Prozent erreicht worden waren) oder in einer Mischform berechnet werden – etwa „vor Steuern“. Letztere Methode wird mittlerweile genutzt, um der laufenden Umstellung auf nachgelagerte Besteuerung zu entsprechen, weil sich stetig ändernde Steuerbelastungen von Renten (und bis 2022 auch von Beiträgen) ansonsten einen Vergleich im Zeitverlauf praktisch unmöglich machen würden. 70 Prozent nach „reinem Netto“ entsprechen dabei etwa 53 Prozent nach heutiger Berechnungsweise. Insgesamt ist es wichtig, die Definitionen von Zähler und Nenner möglichst „zeitlos“ zu halten, um Entwicklungen der GRV-Leistungsfähigkeit akkurat erfassen zu können. Wenn aber beispielsweise gefordert wird, die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre müsse sich schrittweise auch im Rentenniveau abbilden, indem die Standardrente schließlich auf 47 Durchschnittslohnjahren beruht, so würde ein nach derartiger Vorgehensweise verbessertes Rentenniveau lediglich rechnerisch vorgespielt und ein nominal konstantes Niveau wäre faktisch geringer.
Von stabilen Leistungen zu möglichst niedrigen Arbeitgeberbeiträgen
Im Zuge einer in der Nachwendezeit maßgeblich von Arbeitgebenden und Finanzwirtschaft vorangetriebenen Debatte über angeblich schädliche Lohnnebenkosten und den Mehrwert kapitalmarktbasierter Altersvorsorge erodierte der beschriebene Konsens über gute Absicherung bei fairer Belastung allerdings rasch. Nach nur einem knappen Jahrzehnt der systematischen Nettolohnanpassung wurde im Jahr 2000 zunächst bloß nach Preisen angepasst, um schließlich formal zur Bruttolohnanpassung zurückzukehren. Während dies begrifflich zunächst vorteilhaft für Rentenbeziehende wirkt (da bei tendenziell steigenden Beitragssätzen eine Nettosteigerung etwas geringer ausfiele), wurde die Bezugnahme auf den Bruttolohn durch den Einbau des sogenannten „Riester-Faktors“, der die Entwicklung echter und unterstellter zusätzlicher Altersvorsorgebeiträge abbildet, stark modifiziert. Beabsichtigt wurde damit, dass nicht nur das Bruttoniveau, sondern sogar das Nettorentenniveau, das zuvor ja noch bewusst weitgehend konstant gehalten worden war, in den Folgejahren merklich absinkt. Man verabschiedete sich also von anhaltend angemessener Versorgung durch die gesetzliche Rente und wandte sich stattdessen einer „einnahmenorientierten Ausgabenpolitik“ zu, in der ein zwar nicht fixer, aber doch möglichst stark gedämpfter Beitragssatz im Mittelpunkt stand. Die absehbar resultierenden Versorgungslücken – wo strukturell weniger eingenommen wird, müssen Renten entsprechend geringer ausfallen – sollten fortan durch staatlich geförderte private „Zusatzvorsorge“ ausgeglichen werden. Der Begriff „Ersatzvorsorge“ wäre also treffender. Diese kostenorientierte Ausrichtung wurde später noch durch die Ergänzung um einen „Nachhaltigkeitsfaktor“ verstärkt, der näherungsweise die Entwicklung des Rentner*innen/Beitragszahler*innen-Verhältnisses berücksichtigt. Grundsätzlich ist das gesetzliche Rentensystem in Deutschland damit auf Autopilot eingestellt, um im weiteren demografischen Wandel die Beitragsseite zu „entlasten“ und dafür ein allmähliches Absinken des Rentenniveaus in Kauf zu nehmen. Es liegt auf der Hand, dass diese Entlastung zwar für die Arbeitgebenden gilt, nicht aber für die Beschäftigten, die den so aufgerissenen Lücken mit (oftmals ungeeigneten und überteuerten) Ersatzprodukten hinterhersparen müssen und in der Konsequenz erheblich mehr bezahlen (siehe Schäfer 2015). Für den demografischen Wandel gilt im Übrigen: Er wird in den nächsten Jahrzehnten erstens voraussichtlich weniger stark ausfallen als noch vor einiger Zeit angenommen. Insofern hat das Rentensystem schon stärkere Anstiege verarbeitet, als sie nun absehbar sind. Zweitens geht es bei der Finanzierung der Rente eben nicht um bloße Alterskohorten („Junge zahlen für Alte“), sodass das verbreitete Denken in Altersquotienten unscharf ist. Tatsächlich relevant ist vielmehr die Lage auf dem Arbeitsmarkt („Beschäftigte zahlen für Rentner*innen“), und entsprechend kann die Finanzierung anders als oft nahegelegt eben nicht nur mithilfe von Altersgrenzen, sondern gerade auch durch Maßnahmen für möglichst verbreitete und gute Beschäftigung erleichtert werden.
Im Zuge der rabiaten Dämpfungsmaßnahmen bezüglich des Rentenanstiegs sank das nun verwendete Niveau vor Steuern insbesondere im Jahrzehnt nach 2004 von etwa 53 auf etwa 48 Prozent ab. Die gesetzliche Rentenversicherung hat damit also etwa ein Zehntel ihrer traditionellen Lohnersatzfunktion verloren. Der finanzielle „Absturz in die Rente“, den es wegen des niemals vollständigen Lohnersatzes immer in irgendeiner Weise gab, der aber in den früheren Dimensionen allgemein verkraftbar und akzeptiert war, fällt deshalb heute stärker und damit schmerzhaft aus. Auch ab der Mitte der 2010er-Jahre war der „Autopilot nach unten“ grundsätzlich noch aktiv, wirkte wegen der sehr positiven Arbeitsmarktentwicklung aber praktisch nicht mehr niveausenkend. Um einen weiteren, für Alterssicherung und Systemakzeptanz endgültig problematischen Rückgang des Sicherungsniveaus in (arbeitsmarkt-)demografisch ggf. wieder schwierigeren Zeiten vorsichtshalber unmöglich zu machen, wurde dieser Mechanismus schließlich mit einer erneuten Reform eingehegt: Formal weiterhin gültig, wurde und wird er von 2019 bis 2025 von einer „Haltelinie“ ausgebremst: Würde das Rentenniveau nach eigentlichem Anpassungsmechanismus in diesem Zeitraum unter 48 Prozent sinken, so wäre der aktuelle Rentenwert so anzuheben, dass diese Untergrenze eben nicht gerissen, sondern exakt eingehalten wird. Schon damals war absehbar, dass diese Sicherungskonstruktion in der kurzen Phase bis 2025 kaum praktische Relevanz haben würde, weil das Niveau in diesen Jahren vor der vielfach als Horrorszenario beschriebenen „Babyboomer-Rentenwelle“ jedenfalls nicht maßgeblich unter 48 Prozent sinken würde.
Reformvorhaben der Ampel – und von Schwarz-Rot?
Gleichwohl hatte die rentenpolitische „Trockenübung“ ihren Wert, weil sie als konzeptionelle und rechtliche Blaupause für zeitlich weiter reichende Pläne der ab Ende 2021 bestehenden „Ampel“-Koalition dienen konnte. Diese verständigte sich darauf, die Haltelinie bis 2039/2040 zu verlängern, was wegen der sonst wahrscheinlichen weiteren Niveaureduzierungen – für 2040 wird nach geltendem Recht nur noch von etwa 45 Prozent ausgegangen – einen offensichtlichen Mehrwert hätte. Zur Finanzierung entsprechend höherer Leistungen wären unter sonst gleichen Bedingungen wiederum etwas höhere Beiträge notwendig. Während nach dem Status quo bis 2040 ein Beitragssatzanstieg von heute 18,6 Prozent auf dann 21,3 Prozent prognostiziert wird, wären es bei fortdauernder 48 Prozent-Haltelinie womöglich 22,6 Prozent – eventuell leicht gedämpft durch die Erträge eines als „Generationenkapital“ bezeichneten Rentenreservefonds. Als Vorgriff auf die beabsichtigte Reform nahm die Koalition bereits 2022 ein weiteres Element in das Anpassungsrecht auf: Sobald die Haltelinie erstmalig greifen muss, würde in den Folgejahren streng und nach einem viel einfacheren System exakt nach dem Zielniveau 48 Prozent angepasst. Aus der zeitweiligen Untergrenze würde also – allerdings auch nur befristet überlagernd und ohne dauerhafte Streichung der eigentlichen Anpassungsformel – ein fixiertes Niveau. Tatsächlich greift diese spezielle Regel aktuell: Da die Haltelinie 2024 erstmalig greifen musste (wenn auch nur minimal), wird der aktuelle Rentenwert zur Jahresmitte 2025 vereinfacht durch Rückrechnung aus einem 48 Prozent-Niveau bestimmt.
Ein 2024 im Detail präsentiertes Reformkonzept für die um 15 Jahre verlängerte Haltelinie inklusive Anpassung nach Zielniveau wurde schließlich als Gesetzesvorhaben „Rentenpaket II“ vom Kabinett auf den Weg gebracht und schaffte es im Bundestag immerhin in die öffentliche Anhörung. Zu einem Beschluss kam es wegen des Scheiterns der Koalition im November 2024 allerdings nicht mehr. Mit Wirkung bis 2026 (wegen der letztmalig betroffenen Anpassung 2025) gilt damit zwar noch die „kurze Haltelinie“ der großen Koalition. Danach könnte es – sofern nicht entsprechend gesetzgeberisch gegengesteuert wird – durch die grundlegend auf Beitragssatzdämpfung gepolte und nach wie vor im Gesetz stehende Anpassungsformel wieder zu Niveauabsenkungen kommen. Im Vertragsentwurf der voraussichtlichen schwarz-roten Koalition wird nun zwar eine Verlängerung der Haltelinie bis 2031 in Aussicht gestellt. Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung dieser Maßnahme noch unklar, und sie würde wegen der deutlich kürzeren Laufzeit auch nicht den deutlichen „Niveauverlusten“ entgegenwirken können, die für die 2030er-Jahre weitgehend absehbar sind.
Am Reformvorhaben der „Ampel“ entzündete sich teils erhebliche Kritik, die auch aus den Reihen eines Koalitionspartners kam und gerade im medialen Diskurs üblicherweise einfach repliziert wurde. In der Öffentlichkeit konnte damit der Eindruck entstehen, mit einer auch im weiteren demografischen Wandel geltenden Niveaugarantie werde eine fundamental ungerechte Lastenverteilung zwischen Rentner*innen und Arbeitnehmer*innen bewirkt. Behauptet wurde ein grundsätzlicher Konflikt zwischen Geburtskohorten, der sich plakativ so zusammenfassen ließe: „Die heutigen Rentner*innen kriegen mehr, die Jüngeren müssen dafür bezahlen und bekommen später doch keine vernünftige Rente.“ Von einer im individuellen Lebensverlauf von Versicherten stabileren Einkommenslage – heute etwas mehr in die Rentenkasse zahlen, später aber auch merklich mehr Rente bekommen und damit gleichmäßiger teilhaben können – war im Kontext der verbreiteten „Aktuell Alte gegen aktuell Junge“-Diskussion kaum noch die Rede. Die geplante Verlängerung der Niveaugarantie erschien also nicht mehr als Instrument für besseren sozialen Schutz, sondern als „Waffe der heute Alten“ in einem massiven Generationenkonflikt. Fraglich ist, ob diese Interpretation jenseits der mitunter unnötig scharfen Sprache zumindest in ihrem inhaltlichen Kern zutrifft.
Haltelinie: Auch Jüngere profitieren
Tatsächlich kann gezeigt werden, dass dies eben nicht der Fall ist. Dazu ist es zunächst hilfreich, keine Querschnittsperspektive einzunehmen, in der noch dazu ein striktes Interesse an Vermeidung von Rentenversicherungsbeiträgen unterstellt wird, sondern das wirkliche Interesse der Versicherten an guten Einkommen im gesamten Lebensverlauf zu berücksichtigen. In dieser realistischen Betrachtungsweise werden Beschäftigte nicht nur als Beitragszahlende, sondern auch als spätere Rentner*innen betrachtet. Dass hingegen Arbeitgeber*innen und in deren Sinne Denkende und Forschende Sozialversicherungsbeiträge und deren ggf. rasche Anstiege unter sonst gleichen Bedingungen als bloße Last betrachten, ist zunächst einmal verständlich. Schließlich steht der Zahlung dieser Beiträge, die im deutschen Sozialversicherungssystem üblicherweise hälftig durch die Arbeitgebenden zu leisten ist, für sie kein wirtschaftlicher Gegenwert gegenüber. Für Versicherte gilt dies gerade nicht, denn im Unterschied zu Steuern (deren Gegenwert niemals spezifisch zugesichert ist, sondern im Rahmen der daraus erbrachten staatlichen Leistungen vergleichsweise diffus bleibt) können sie aufgrund ihrer Rentenbeiträge konkrete Erträge erwarten – zumal im deutschen, sehr stark auf Vorleistung abstellenden System.
Dass zuverlässige soziale Absicherung und nicht die dafür notwendigen Kosten Ausgangspunkt der Gedanken von Beschäftigten hinsichtlich der Rente sind, hat kürzlich etwa das gemeinsam von Arbeitnehmerkammer Bremen, Arbeitskammer des Saarlandes und DGB präsentierte SozialstaatsRadar 2025 auf Grundlage einer bundesweiten Befragung eindrücklich gezeigt: Danach verlangt die Bevölkerung im Mittel und bei nur geringen Schwankungen nach Alter und Parteipräferenz ein Alterssicherungssystem (unter Einschluss der gesetzlichen Rente), das 75 Prozent des vor Rentenbeginn erreichten Nettoeinkommens ersetzt. Dieses lebensnahe Konzept ist zwar nicht direkt mit dem sehr technischen Konstrukt des Rentenniveaus in der gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbar, doch ist der Wunsch nach einer strukturellen Lebensstandardsicherung im Alter unverkennbar. Dass dieser Wunsch nicht billig oder gar kostenlos erfüllt werden kann, liegt auf der Hand, und die Arbeitnehmer*innen sind sich sehr wohl bewusst, welchen Wert das (immerhin) verbliebene gesetzliche Sicherungsniveau für sie hat. Gefragt, ob sie zu etwas höheren Beiträgen bereit wären, wenn dadurch das bisherige Rentenniveau zumindest gehalten werden könnte – letztlich entspricht dies dem Szenario der Haltelinie –, stimmten 63 Prozent zu. Weitere 12 Prozent wären sogar zu deutlich höheren Beiträgen für ein wieder höheres Leistungsniveau bereit. Entgegen der These vom Generationenkonflikt sind diese Werte über alle Altersgruppen hinweg ziemlich stabil, wobei sogar 23 Prozent der Befragten unter 30 Jahren zu deutlich höheren Beiträgen bereit wären.
Die trotz gegenläufiger Erzählungen offensichtlich verbreitete Intuition, dass höhere Rentenbeiträge für bessere Renten auch im bestehenden Umlagesystem gut „investiertes“ Geld wären, trügt wiederum nicht, wie die aktuelle Studie „Stabilisierung des Rentenniveaus: Wer verliert und wer gewinnt wirklich?“ verdeutlicht: Bildet man Beiträge und Altersrenten in modellhaften Lebensläufen ab, ergibt sich darin für alle Geburtsjahrgänge von 1940 bis 2010, dass eine verlängerte Haltelinie tatsächlich ein gutes Geschäft wäre, weil einem Mehr an Beiträgen immer noch mehr Rente gegenüber stünde. Das für diese Berechnungen notgedrungen aus der Welt privatwirtschaftlicher Finanzprodukte entlehnte Konzept der Rendite ist zwar in einer umlagefinanzierten und sozialen Versicherung durchaus heikel. Gleichwohl kann so gezeigt werden, dass sich die Teilhabe an der Solidargemeinschaft im Regelfall auch finanziell bezahlt macht. Hinzu kommt: Zwar gäbe es nach den Ergebnissen der Studie Schwankungen hinsichtlich erwartbarer zusätzlicher „Renditen“, doch würde die Reform eher noch bisherige Ungleichheiten zwischen den Geburtsjahrgängen ausgleichen und insofern glättend wirken.
Haltelinie: Auch Rentner*innen tragen die Kosten des demografischen Wandels
Selbst wenn man aber von dieser eigentlich notwendigen Lebenslaufperspektive abgeht und stattdessen im Hier und Jetzt vergleicht, wird deutlich, dass die These der Einseitigkeit („Junge tragen die volle Last“) nicht zutrifft. Auch bei einer bloßen Kurzfristanalyse ist es eben nicht so, dass bei Stabilisierung eines unter Berücksichtigung der GRV-Beitragssatzentwicklung berechneten Niveaus – und genau dies ist das Prinzip der geltenden und vorerst doch nicht verlängerten Haltelinie – jegliche Last auf die Beitragszahler*innen verteilt wird und Rentner*innen nicht betroffen sind. Ein solcher Effekt könnte nur auftreten, wenn rein nach Bruttolohnentwicklung unter Ausblendung der Beitragssätze angepasst würde, um das Bruttorentenniveau konstant zu halten. In diesem Fall würde das für Rentner*innen tatsächlich – nämlich „netto im Geldbeutel“ – relevante Versorgungsniveau im Vergleich zu den Beitragszahlenden und ihren Nettolöhnen bei im demografischen Wandel steigenden Beitragssätzen immer weiter wachsen. Grobe Beispielrechnungen sollen diesen Zusammenhang im Folgenden illustrieren, wobei zur Vereinfachung nur von Rentenversicherungsbeiträgen ausgegangen wird und weitere Beiträge und Steuern ignoriert werden. Diese Simplifizierungen ändern allerdings nichts an der grundsätzlichen Aussagekraft hinsichtlich der Lastverteilung.
Zunächst werden folgende Annahmen zu relevanten Rechengrößen getroffen:
- Standardrente (brutto): 2.000 Euro
- GRV-Beitragssatz: 20 % [also 10 % Arbeitnehmerbeitrag]
- Durchschnittslohn (brutto): 4.000 Euro
Daraus resultieren unmittelbar:
- Standardrente (netto): 2.000 Euro [2.000 Euro – 0 % (da hier keine relevanten Abzüge)]
- Durchschnittslohn (netto): 3.600 Euro [4.000 Euro – 10 %]
- Rentenniveau (brutto): 50 % [2.000 Euro / 4.000 Euro]
- Rentenniveau (netto): 55,6 % [2.000 Euro / 3.600 Euro]
Für die beiden folgenden Szenarien wird nun jeweils unterstellt:
- Entwicklung der Bruttolöhne: +3 %
- Entwicklung des GRV-Beitragssatzes: +2 Prozentpunkte [also auf 22 % Gesamt- bzw. 11 % Arbeitnehmerbeitrag]
Im ersten Szenario wird eine Rentenanpassung nach Bruttolohnsteigerung angenommen. Es resultieren:
Szenario 1: Rentenanpassung nach Bruttolohnsteigerung
- Durchschnittslohn (brutto): 4.120 Euro [4.000 Euro + 3 %]
- Durchschnittslohn (netto): 3.666,80 [4.120 Euro – 11 %]
- Standardrente (brutto): 2.060 Euro [2.000 Euro + 3 %]
- Standardrente (netto): 2.060 Euro [2.060 Euro – 0 %]
- Rentenniveau (brutto): 50 % [2.060 Euro / 4.120 Euro]
- Rentenniveau (netto): 56,2 % [2.060 Euro / 3.666,80 Euro]
In diesem Szenario würde also das tatsächliche Versorgungsniveau im Alter bezogen auf das im Arbeitsleben verfügbare Nettoeinkommen parallel zum Beitragssatz immer weiter anwachsen. Erstens wäre es somit wohl unnötig hoch – denn warum sollte die relative Versorgung im Alter immer besser werden, nachdem sich die Gesellschaft zuvor im sozialpolitischen Aushandlungsprozess auf einen anderen Zielwert für das Nettorentenniveau verständigt hatte? Dieser These könnte man direkt entgegenhalten, dass aber gar nicht von netto verfügbaren, sondern von den ursprünglichen Bruttoeinkommen auszugehen sei. Schließlich ist die Abgabenbelastung nicht in Stein gemeißelt, vielmehr können Arbeitnehmer*innen diese durch ihre Wahlentscheidungen jedenfalls langfristig in gewisser Weise nach ihren Vorsorgepräferenzen steuern. Ganz praktisch wird dieser Einwand aber dadurch wieder entkräftet, dass die generationenübergreifende Struktur der umlagefinanzierten GRV mit entsprechenden Beitragspflichten offenbar für die große Mehrheit der Abgesicherten tatsächlich das Mittel der Wahl ist und sie in puncto Altersvorsorge eben nicht anderweitig mit ihrem Bruttolohn disponieren wollen. Das diesbezüglich bereits erwähnte SozialstaatsRadar 2025 hat außerdem gezeigt, dass die Versicherten öffentliche klar gegenüber privatwirtschaftlicher Leistungserbringung bevorzugen.
Zweitens wäre der Blick von den Rentenbeziehenden auf die Beitragszahlenden zu richten, die die Last einer echten Bruttoanpassung – in Querschnittsbetrachtung – tatsächlich voll tragen müssten. Schließlich hätten sie steigende Beiträge (und damit unter sonst gleichen Bedingungen geringere Nettolöhne) zu verkraften, während für die Rentner*innen ohne Einschnitte gilt: „Bruttolohnsteigerung gleich Nettorentenanpassung“. Ein solches Modell wäre bei bereits demografisch bedingten Beitragssatzveränderungen jedenfalls über längere Zeiträume wohl nicht vermittelbar. Insofern aus gutem Grund wurden in Deutschland zunächst bestehende derartige Vorgaben nicht stringent angewendet und mit der Rentenreform 1992 schließlich auch formal abgeschafft – fortan fand die GRV-Beitragssatzentwicklung ganz konkret Berücksichtigung. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass damals anders als im hier illustrativ verwendeten schlanken Modell grundsätzlich die komplette Abgabenentwicklung berücksichtigt wurde, wodurch sich Entwicklungen jenseits der Rentenversicherung auf die Rentenanpassungen auswirken. Hinsichtlich der weiteren Sozialversicherungsbeiträge ist dies auch in den heute verwendeten oder diskutierten Modellen noch so. Diesbezüglich „sauberer“ und einfacher wäre eine Systematik, die tatsächlich nur die Bruttolohn- und Beitragssatzentwicklungen abbildet (siehe Schmähl 1999). Dass ein entsprechend beitragssatzsensibles Modell keine unnötig hohe Versorgung bewirkt, kann nun einfach anhand weiterer Berechnungen gezeigt werden.
In diesem zweiten Szenario wird eine Rentenanpassung nach Bruttolohnsteigerung unter Berücksichtigung der GRV-Beitragssatzentwicklung angenommen. Es resultieren:
Szenario 2: Rentenanpassung nach Bruttolohnsteigerung unter Berücksichtigung der GRV-Beitragssatzentwicklung
- Durchschnittslohn (brutto): 4.120 Euro [4.000 Euro + 3 %]
- Durchschnittslohn (netto): 3.666,80 [4.120 Euro – 11 %]
- Standardrente (brutto): 2.037,11 Euro [2.000 Euro + 3 % und multipliziert mit einem Faktor, der den Anstieg des Arbeitnehmerbeitrags von 10 % auf 11 % abbildet ((1-0,11)/(1-0,1))]
- Standardrente (netto): 2.037,11 Euro [2.037,11 Euro – 0 %]
- Rentenniveau (brutto): 49,4 % [2.037,11 Euro / 4.120 Euro]
- Rentenniveau (netto): 55,6 % [2.037,11 Euro / 3.666,80 Euro]
Anders als bei der Anpassung rein nach Bruttolohnentwicklung würde somit nicht mehr das bei substanziellen und akzeptierten Abgabenpflichten lebensfremde Bruttorentenniveau, sondern das Nettorentenniveau konstant gehalten. Unter lebensnaher Betrachtung tatsächlich verfügbarer Arbeits- und Renteneinkommen bliebe also ein entsprechendes Maß an Altersversorgung gewährleistet, bei dem gleichzeitig die zusätzliche Beitragsbelastung der Arbeitenden angemessen auf die Rentenbeziehenden durchschlägt. Der systematische Unterschied zu Anpassungsmodellen wie dem aktuellen, bei dem der langfristig auf erhebliche Niveausenkung ausgerichtete Nachhaltigkeitsfaktor nur durch die befristete Haltelinie ausgebremst wird, ist folgender: Der skizzierte Mechanismus geht eben nicht vom bloßen Querschnitt „heutige Betragszahler*innen vs. heutige Rentner*innen“ aus, der gegenüber dem Längsschnitt des Lebensverlaufs mit Beitragszahlung und späterem Rentenbezug ignorant ist. Vielmehr legt er im allgemeinen langfristigen Interesse auch der heute Beschäftigten ein stabiles Nettoniveau (vor Steuern) zugrunde, das verlässliche Versorgung zusichert. Zu formalen Verteilungswirkungen verschiedener Anpassungsmodelle in der kurzen Frist siehe im Übrigen Gauckler/Hofmann 2024.
Fazit
Die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung hat im öffentlichen Diskurs ein erhebliches Imageproblem, das von interessierter Seite bewusst befeuert wird: Sie wird seit Jahrzehnten immer wieder als langfristig kaum tragfähiges Schneeballsystem karikiert, von dem die heutigen Rentner*innen zwar noch gut leben könnten und sich deshalb auch für unmittelbar verbesserte Leistungen stark machten, das den Jüngeren aber bestenfalls noch wenig bieten könne und werde. Konkret danach gefragt sieht die Bevölkerung das aber offenbar anders: Ein Rentensystem mit gutem und stabilem Nettoniveau wird über Generationen hinweg gewünscht, und die Versicherten wären dafür auch ganz überwiegend zu wenigstens etwas höheren Beiträgen bereit. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass beide Seiten des nur vermeintlichen Konflikts ihren fairen Beitrag im Rahmen langfristig stabiler Versorgung leisten würden, wenn man die Renten niveaustabilisierend unter Berücksichtigung der Rentenbeitragssatzentwicklung anpasst. Insofern wäre eine Entfristung, mindestens aber eine weitreichende Verlängerung der beitragssatzsensiblen „Haltelinie“ eindeutig sinnvoll. Davon unabhängig bleibt die Frage zu klären, ob ein gegebenes Sicherungsniveau tatsächlich ausreicht. Hinsichtlich des aktuell in der GRV „erreichten“ Werts von 48 Prozent ist dies angesichts der formulierten Sicherungsbedarfe und auch mit Blick auf die Sicherungsversprechen vergleichbarer Sozialstaaten mit meist höherem öffentlichen Niveau und/oder wirksamerer Zusatzvorsorge wohl zu verneinen.
Verzeichnis nicht verlinkter Literaturhinweise
Gauckler, Ludwig/Hofmann, Nico 2024: Verteilungsaspekte von Rentenanpassungsmechanismen, in: Deutsche Rentenversicherung, Bd. 79, Nr. 1, S. 49-68.
Schäfer, Ingo 2015: Die Illusion von der Lebensstandardsicherung. Eine Analyse der Leistungsfähigkeit des ›Drei-Säulen-Modells‹, Bremen.
Schmähl, Winfried 1999: Die Nettoanpassung der Renten „auf dem Prüfstand“: Für eine Modifizierung der Nettoanpassung und für einen Übergang zu einer „lohn- und beitragsbezogenen“ Anpassungsformel – Gründe und Wirkungen, in: Deutsche Rentenversicherung, Bd. 54, Nr. 8-9, S. 494-507.
Zurück zum WSI-Blog Work on Progress
Die Beiträge der Serie
- Florian Blank/Jutta Schmitz-Kießler/Eike Windscheid-Profeta: Mythen der Sozialpolitik: Eine Blogserie (30.07.2024)
- Camille Logeay/Florian Blank: Das Generationenkapital – alle profitieren? (30.07.2024)
- Jennifer Eckhardt: Von wegen Hängematte: Zur Unzugänglichkeit von Sozialleistungen (01.08.2024)
- Dagmar Pattloch: Das Zugangsalter in die Rente der Deutschen Rentenversicherung Bund. Eine Richtigstellung (08.08.2024)
- Johannes Geyer: Die Grundrente: Was ist das eigentlich? (15.08.2024)
- Eileen Peters/Yvonne Lott: Die unbezahlte Doppelbelastung: Warum Frauen nicht noch mehr arbeiten können (22.08.2024)
- Jutta Schmitz-Kießler: Hartnäckig, aber falsch: Die Kritik an der Bürgergelderhöhung (30.08.2024)
- Eike Windscheid-Profeta: Jung, faul, wehleidig: Hat die „Gen Z“ den Generationenvertrag gekündigt? (04.09.2024)
- Ingo Schäfer: Die Wahrheit: Warum Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung richtig sind (27.09.2024)
- Nina Weimann-Sandig: Betreuungskrise: Warum mehr Stunden nicht helfen (04.10.2024)
- Andreas Jansen: Nein! Die Rentenangleichung ist nicht für alle Menschen in Ostdeutschland von Vorteil (29.11.2024)
- Eike Windscheid-Profeta: Krankheitsbedingte Fehlzeiten: Zwischen Bettkanten und dünnen Personaldecken (13.12.2024)
- Johannes Steffen: Die Bürgergeld-Reform von 2023 – Quelle allen Übels? (04.02.2025)
- Michaela Evans-Borchers/Christoph Bräutigam: Zukunft der Pflege: „Die“ Pflege gibt es nicht! (07.02.2025)
- Eike Windscheid-Profeta: Arbeitsvolumen in Deutschland: (Wieder) mehr und länger arbeiten für Wohlstand und Wohlfahrt? (07.04.2025)
- Magnus Brosig: Faire Haltelinie: Warum ein dauerhaft stabiles Rentenniveau sinnvoll und gerecht ist (14.04.2025)
weitere Beiträge in Vorbereitung
Autor
Dr. Magnus Brosig ist Referent für Sozialversicherungs- und Steuerpolitik bei der Arbeitnehmerkammer Bremen. Er arbeitet u.a. zu Strukturproblemen und Entwicklungsperspektiven des deutschen Alterssicherungssystems, insbesondere der gesetzlichen Rentenversicherung.




