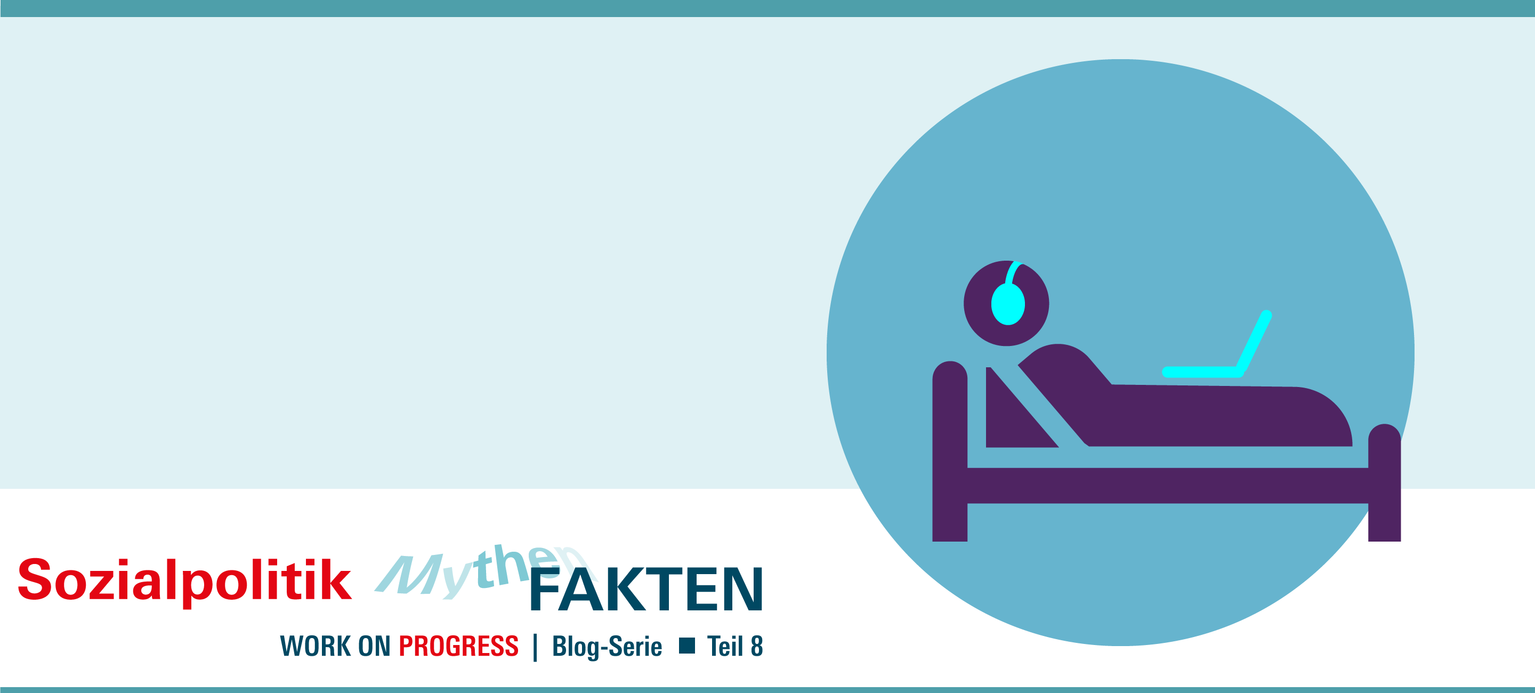
Quelle: WSI
Eike Windscheid-Profeta, 04.09.2024: Jung, faul, wehleidig: Hat die „Gen Z“ den Generationenvertrag gekündigt?
Ständig krank, nur auf Freizeit orientiert? Solchen immer wieder bemühten Verallgemeinerungen und Vorurteilen gegenüber Jüngeren liegen regelmäßig keine oder nur unzureichende empirische Beweise zugrunde.
Alt gegen Jung – vermeintliche Generationenkonflikte sind immer wieder Gegenstand der Debatten um den Wohlfahrtsstaat und Sozialpolitik (z. B. hier oder hier). Transportiert werden damit häufig Fragen der Gerechtigkeit im Geben und Nehmen zwischen den Generationen und einer vermeintlichen Privilegierung einzelner Gruppen: Bekommen Rentner*innen zu viel? Leisten junge Generationen zu wenig? Sind Beiträge und Lasten fair verteilt oder ist der Generationenvertrag bedroht?
Eines vorweg: Wenn in sozialpolitischen Debatten der Generationenkonflikt erwähnt wird, wird es in der Regel ziemlich eindimensional! Denn natürlich geht es bei Verteilungsfragen, die in der Sozialpolitik zentral sind, nicht nur um den Ausgleich zwischen Generationen, sondern auch zwischen sowie innerhalb von vielen anderen gesellschaftlichen Gruppen. Und überhaupt: Wer genau sind die Jungen und wer die Alten?
Vermeintliche Konflikte um Generationengerechtigkeit können viele Facetten haben. Neben rein demografischen Größen und ökonomischen Verteilungsströmen und ihrer politischen Bewertung gibt es auch immer wieder Erzählungen über manifeste soziale oder kulturelle Unterschiede zwischen Generationen. Auch diesen wird sozialpolitische Bedeutung zugeschrieben und insofern besitzen sie viel Potenzial für soziale Spaltung und eine hohe politische Sprengkraft. Eine aktuell besonders prominent diskutierte Frage lautet: Fehlen „den Jungen“ Leistungsbereitschaft und Arbeitsmoral und haben sie damit den Generationenvertrag aufgekündigt? (siehe z. B. hier).
Immer wieder werden generationelle Unterschiede bei der Arbeitsleistung oder im Krankheits- bzw. Gesundheitsverhalten behauptet und die Jüngeren in ein schlechtes Licht gerückt: Ständig krank? Kein Bock auf Arbeit? Nur an Freizeit interessiert? Das alles soll gerade auf die „jungen“ Generationen (insbesondere die „Gen Z“, Geburtsjahrgänge 1995 bis 2010) zutreffen, die durch ihr Verhalten das Sozialmodell Deutschland gefährden (siehe z. B. hier, hier oder hier).
Allein: Derlei „Generationeneffekte“ gibt es gar nicht. Ein Blick in die empirische Evidenz:
Die „Generation“ als Analysekategorie
In den Sozialwissenschaften hat der Begriff der „Generation“ durchaus Tradition. Eine grundlegende und nach wie vor häufig verwendete Definition lieferte schon 1928 Karl Mannheim, der – vor allem um den seinerzeit gängigen biologischen Gesellschaftstheorien etwas entgegenzusetzen – auf die sozialen Komponenten von „Generationen“ abstellte (siehe hier). Er definierte „Generation“ als ein soziales Gebilde, dessen nahezu gleichaltrige Mitglieder beruhend auf einem gemeinsamen und kollektiven historischen Erfahrungshorizont relativ stabile und ähnliche Einstellungen aufweisen. Seither wird die „Generation“ immer wieder gern als hoch aggregierende Ordnungskategorie verwendet: Eine vermeintliche, auf Basis eng beieinander liegender Geburtsjahrgänge miteinander verbundene (Schicksals-)Gemeinschaft von Individuen verweist auf Identifikation und Gemeinsamkeit. Hieraus wiederum wird nicht selten auf kollektive Interessen geschlossen, die Ausweis eines vermeintlichen „Generationencharakters“ sein sollen: Besonnene „Boomer“, die auf Sicherheit bedachte „Generation X“, die alles hinterfragenden und kritischen „Millennials“, die faule und nur an sich selbst interessierte „Gen Z“ usw. (siehe z. B. hier).
Dieses Denkmuster bietet sich vielleicht als Grundlage für zielgruppenspezifisches Marketing an (so verwenden Marktforschung und Werbeindustrie Generationen-Label immer wieder im Rahmen von Produkt- und Vermarktungsstrategien, wie etwa bei der „Generation Golf“; siehe zum Generationenbegriff im Marketing z. B. auch hier). Doch derlei Kollektivzuschreibungen sind in der Regel nicht nur empirisch nicht haltbar, sie sind auch konzeptionell irreführend – denn wie Martin Schröder von der Universität des Saarlands hier treffend erklärt, werden bisweilen verschiedene Effekte miteinander vermischt:
„Stellt man Alters- und Periodeneffekte in Rechnung, bleiben kaum Generationeneffekte übrig. Man kann also Einstellungen von Menschen mit ihrem Alter erklären und man kann Einstellungen von Menschen damit erklären, wann sie befragt wurden. Aber man kann Einstellungen von Menschen kaum mit deren Geburtsjahr erklären. Und insofern gibt es keine Generationen.“
Als empirische Kategorie ist der Begriff der Generation oft unzureichend methodisch fundiert und eignet sich in den meisten Fällen nicht zur systematischen Analyse (siehe hier).
Allenfalls gibt es so etwas wie Kohorteneffekte. Kohorten sind Teilpopulationen, die sich durch ein gemeinsames Startereignis auszeichnen, z. B. das Geburtsjahr (aber auch andere Ereignisse kommen infrage, z. B. bestimmte „Heiratskohorten“, „Berufseintrittskohorten“ etc.). Von Generationseffekten (im Sinne von Geburtskohorten) kann allerdings nur dann gesprochen werden, wenn Menschen gleichen Alters zum gleichen Zeitpunkt je nach Geburtszeitpunkt unterschiedliche Einstellungen haben. Insbesondere die typischerweise auf Querschnittsbefragungen von Personen unterschiedlichen Alters basierenden Ergebnisse, die herangezogen werden, um Generationenunterschiede zu belegen, werden vor diesem Hintergrund regelmäßig falsch interpretiert.
Ständig krank?
Erstes Beispiel: Lassen sich Angehörige der „Gen Z“ öfter krankschreiben? Daten der Techniker Krankenkasse für das Jahr 2023 zeigen, dass jüngere Erwerbspersonen zwischen 15 und 24 Jahren durchschnittlich aufgrund von knapp vier Krankheitsfällen mit insgesamt etwa fünf Fehltagen pro Fall abwesend waren, während die Gruppe der ab 60-Jährigen nur etwa 1,5 Krankheitsfälle im Jahr aufwies – allerdings bei im Durchschnitt 20 Tagen Abwesenheit pro Fall (siehe hier).
Junge Menschen sind demnach tatsächlich öfter krank. Dass es sich hierbei um ein „generationelles“ und vor allem auf Mutwilligkeit beruhendes Phänomen handeln soll, ist jedoch falsch. Es war früher nämlich auch schon so: Dass jüngere Beschäftigte (im Durchschnitt) öfter arbeitsunfähig sind und ältere Beschäftigte weniger häufig arbeitsunfähig, dafür aber (im Durchschnitt) länger, ist ein gut belegter Befund der Arbeits- und Gesundheitsforschung (siehe z. B. hier). Auch ein Blick in die Fehlzeitenstatistik zeigt: Über die Dekaden sind die Arbeitsunfähigkeitsfälle und -zeiträume stabil geblieben, was die Verteilung auf einzelne Altersgruppen angeht. Insofern sind Verbindungen zu einzelnen Generationen – wie aktuell etwa zur „Gen Z“ – prinzipiell konstruiert.
Es handelt sich nämlich schlicht um Lebensverlaufs- und Alterseffekte: Während jüngere Menschen zwar öfter (geringfügig) erkranken, sich dafür jedoch schnell wieder erholen können, leiden ältere Menschen häufiger unter Krankheiten, die längere Ausfallzeiten mit sich bringen, etwa aufgrund körperlichen Verschleißes, verlangsamter Rekonvaleszenz oder verminderter Bewältigungsressourcen, sodass zur Erholung mehr Zeit erforderlich ist (siehe hier). Das zeigt: Es geht nicht um mutwilligen Absentismus – über den einzelnen Lebensverlauf hinweg verändern sich ganz einfach Risiken zu erkranken und haben individuelle Ressourcen der Rekonvaleszenz oder auch der körperliche Verschleiß einen Einfluss auf Anzahl und Dauer krankheitsbedingter Fehlzeiten.
Kein Bock auf Arbeit?
Und wie steht es um das Arbeitsengagement der „Gen Z“? Wenn es um das Erwirtschaften des Geldes für wohlfahrtsstaatliche Ausgaben geht, wird häufig angeführt, die jungen Generationen hätten – im Gegensatz zu älteren Generationen – zu wenig „Bock auf Arbeit“. Es steht der Vorwurf im Raum, junge Beschäftigte seien kaum leistungsbereit, ihr Interesse an Work-Life-Balance hingegen sei außerordentlich hoch.
Beim Blick auf die Arbeitsmotivation von Beschäftigten zeigt sich jedoch schnell: Ein Generationenunterschied liegt nicht vor (siehe zum Folgenden hier), denn typischerweise wächst die Bedeutung, die Menschen ihrer Arbeit beimessen, bis etwa zum 40. Lebensjahr an, bevor sie sukzessive wieder abnimmt – und zwar unabhängig von individueller Kohortenzugehörigkeit oder Periodeneffekten. Insofern ist es ein Alterseffekt, wenn jüngere Beschäftigte im Gegensatz zu den früher geborenen, mittelalten Beschäftigten ihrer Tätigkeit noch keine vergleichbare Bedeutung beimessen.
Zudem spielt der Befragungszeitpunkt eine Rolle, der bei jüngeren Kohorten später im historischen Zeitverlauf erfolgt – was als generationelles Problem verminderter Arbeitsmotivation gelabelt wird, obgleich alle Beschäftigten im historischen Zeitverlauf aversere Einstellungen zur Arbeit berichten. Das ist wiederum ein Periodeneffekt, der sich etwa daran ablesen lässt, dass tatsächliche und gewünschte Arbeitszeiten im historischen Zeitverlauf abgenommen haben bzw. weiter abnehmen.
Auch hinsichtlich des realen Arbeitsengagements lassen sich keine Differenzen nach Geburtsjahrgängen erkennen (siehe zum Folgenden hier). Ausprägungen eines verminderten Arbeitsengagements, etwa vermittelt über innere Kündigung oder „Dienst nach Vorschrift“, bewegen sich seit vielen Jahren auf einem stabilen Niveau und haben mit Eintritt der „Gen Z“ in den Arbeitsmarkt keine Zunahme erfahren. Darüber hinaus erscheint auch unabhängig von der jeweiligen Work-Life-Balance-Präferenz, ob beispielsweise Mehrarbeit übernommen wird oder Überstunden gemacht werden. Insofern liegen keine Hinweise für spezifische generationelle Einflüsse auf das Engagement am Arbeitsplatz vor.
Nur Freizeit im Kopf?
Und auch, was die Arbeitszeitinteressen angeht, wird der „Generation Z“ häufig unterstellt, sie wolle im Wesentlichen Freizeit und Arbeitszeitverkürzung, speziell die Vier-Tage-Woche. Ein Blick in die empirische Evidenz zeigt jedoch: Die Arbeitszeitpräferenzen in Deutschland weisen über alle Altersgruppen hinweg eine Tendenz zur Verringerung von Wochenstunden auf (siehe hier) und sind nicht spezifisch für junge Menschen oder die „Gen Z“. Zunehmend ausgeprägt ist dieser Wunsch vor allem bei den Personen ab 30 Jahren und aufwärts (siehe hier) – und damit tendenziell sogar stärker bei denen, die gerade nicht jüngeren Geburtskohorten zugehörig sind.
Die Vier-Tage-Woche als ein möglicher Modus von Arbeitszeitverkürzung kommt laut Selbstauskunft nicht nur für junge Beschäftigte infrage: Insgesamt können sich weit über 80 Prozent der Beschäftigten in Deutschland aller Altersklassen eine Umsetzung der Vier-Tage-Woche (bei vollem Lohnausgleich) vorstellen (siehe hier).
Während Wünsche nach besseren Vereinbarkeitschancen, etwa hinsichtlich Kinderbetreuung oder Pflegeverpflichtungen, tatsächlich noch leicht nach Altersklassen variieren (Kinderbetreuung beschäftigt stärker die Altersklasse der Ende 20 bis Ende 30-Jährigen, Pflege von Angehörigen gewinnt eher in der zweiten Lebenshälfte an Bedeutung, siehe hier), sind zentrale Gründe für den Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung, nämlich „mehr Zeit für mich selbst“ und „mehr Zeit für Regeneration“ zu haben, über alle Altersklassen hinweg dominant.
Insofern haben wir es auch hier nicht mit einem spezifisch die Generation Z betreffenden Anspruch auf mehr Autonomie und Selbstbestimmung bei Lage und Dauer täglicher und wöchentlicher Arbeitszeiten zu tun. Es handelt sich vielmehr um einen tief verwurzelten und über alle Beschäftigtengruppen hinweg verbreiteten Wunsch. Dieses Streben nach Arbeitszeitreduktion hat u. a. auch damit zu tun, dass viele Beschäftigte erwarten, überhaupt nicht bis zur Rente durchzuhalten bzw. bereits faktisch die Regelaltersgrenze nicht erreichen (siehe hier und hier).
Fazit
Die Befunde zeigen: Es ist fundamental wichtig, den Begriff der „Generation“ sehr genau von Alters- bzw. Periodeneffekten zu unterscheiden. Ersterer eignet sich prinzipiell weniger gut, um als Basis evidenzbasierter Sozialpolitik zu dienen. Letztere hingegen lassen Schlüsse zu, die sich etwa auf Alternsgerechtigkeit von Sozialleistungen, Gesundheitsprävention oder Arbeitsgestaltung anwenden lassen.
Außerdem werden nicht selten Ergebnisse aus Querschnittsbefragungen dazu verwendet, verallgemeinernde Generationencharakteristika zu konstruieren, aktuell insbesondere etwa für die „Gen Z“. So wird später geborenen Personen etwa eine größere gesundheitliche Achtsamkeit oder berufliche Reflektiertheit zugeschrieben (siehe hier). Ob sich solche Lebenseinstellungen und Verhaltensweisen für eine spezifische Generation verallgemeinern lassen, ist jedoch nur mittels eines längsschnittlich angelegten Interkohortenvergleichs zuverlässig zu sagen, bei dem Befragungs- bzw. Messzeitpunkte in den jeweiligen Altersstufen der Kohortenmitglieder kongruent sind. In der Regel bleibt dieser systematische Vergleich jedoch aus. Man weiß also nicht: Haben früher geborene Personen früher vielleicht genauso gedacht?
Insofern liegen den immer wieder bemühten Vorurteilen und Verallgemeinerungen gegenüber Generationen (im Sinne von Geburtskohorten) regelmäßig keine oder nur unzureichende empirische Beweise zugrunde. Problematisch ist, wenn daraus dennoch sozialpolitische Schlussfolgerungen abgeleitet werden, wie zum Beispiel ein vermeintliches „Gegensteuern“ über eine pauschale Ausweitung bzw. Anreize zur Verlängerung von Arbeitszeiten. Diese stehen dann in Widerspruch zu arbeits- und gesundheitswissenschaftlich gut belegten Alterseffekten, wie etwa im Zeitverlauf variierenden Vereinbarkeits- und Regenerationsbedarfen, und blockieren dafür wichtige Zeiträume. Das wiederum führt überhaupt erst zu gravierenden Auswirkungen auf die Fachkräftesituation und die Finanzierung sozialer Kassen insgesamt (siehe hier).
Zum Weiterlesen / -hören:
Höpflinger (2022): http://www.hoepflinger.com/fhtop/Alter-Kohorten-Periode.pdf
Die Beiträge der Serie
- Florian Blank/Jutta Schmitz-Kießler/Eike Windscheid-Profeta: Mythen der Sozialpolitik: Eine Blogserie (30.07.2024)
- Camille Logeay/Florian Blank: Das Generationenkapital – alle profitieren? (30.07.2024)
- Jennifer Eckhardt: Von wegen Hängematte: Zur Unzugänglichkeit von Sozialleistungen (01.08.2024)
- Dagmar Pattloch: Das Zugangsalter in die Rente der Deutschen Rentenversicherung Bund. Eine Richtigstellung (08.08.2024)
- Johannes Geyer: Die Grundrente: Was ist das eigentlich? (15.08.2024)
- Eileen Peters/Yvonne Lott: Die unbezahlte Doppelbelastung: Warum Frauen nicht noch mehr arbeiten können (22.08.2024)
- Jutta Schmitz-Kießler: Hartnäckig, aber falsch: Die Kritik an der Bürgergelderhöhung (30.08.2024)
- Eike Windscheid-Profeta: Jung, faul, wehleidig: Hat die „Gen Z“ den Generationenvertrag gekündigt? (04.09.2024)
- Ingo Schäfer: Die Wahrheit: Warum Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung richtig sind (27.09.2024)
- Nina Weimann-Sandig: Betreuungskrise: Warum mehr Stunden nicht helfen (04.10.2024)
- Andreas Jansen: Nein! Die Rentenangleichung ist nicht für alle Menschen in Ostdeutschland von Vorteil (29.11.2024)
- Eike Windscheid-Profeta: Krankheitsbedingte Fehlzeiten: Zwischen Bettkanten und dünnen Personaldecken (13.12.2024)
- Johannes Steffen: Die Bürgergeld-Reform von 2023 – Quelle allen Übels? (04.02.2025)
- Michaela Evans-Borchers/Christoph Bräutigam: Zukunft der Pflege: „Die“ Pflege gibt es nicht! (07.02.2025)
- Eike Windscheid-Profeta: Arbeitsvolumen in Deutschland: (Wieder) mehr und länger arbeiten für Wohlstand und Wohlfahrt? (07.04.2025)
- Magnus Brosig: Faire Haltelinie: Warum ein dauerhaft stabiles Rentenniveau sinnvoll und gerecht ist (14.04.2025)
weitere Beiträge in Vorbereitung
Zurück zum WSI-Blog Work on Progress
Autor
Dr. Eike Windscheid-Profeta leitet das Referat Wohlfahrtsstaat und Institutionen der Sozialen Marktwirtschaft in der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung.

