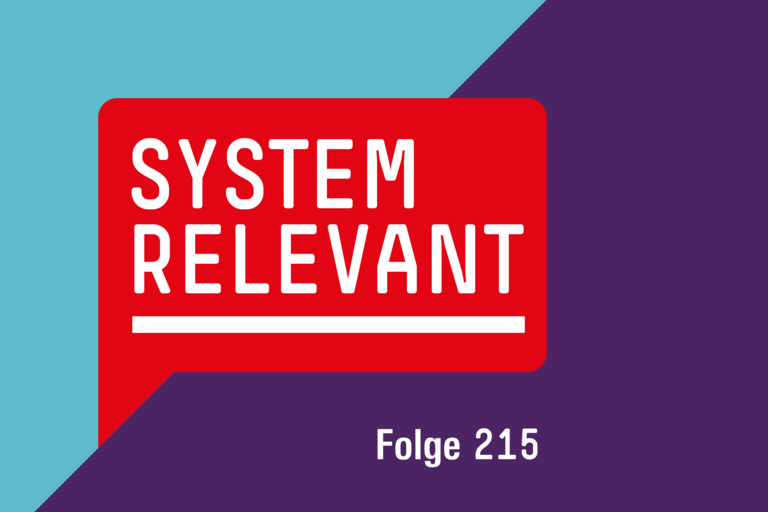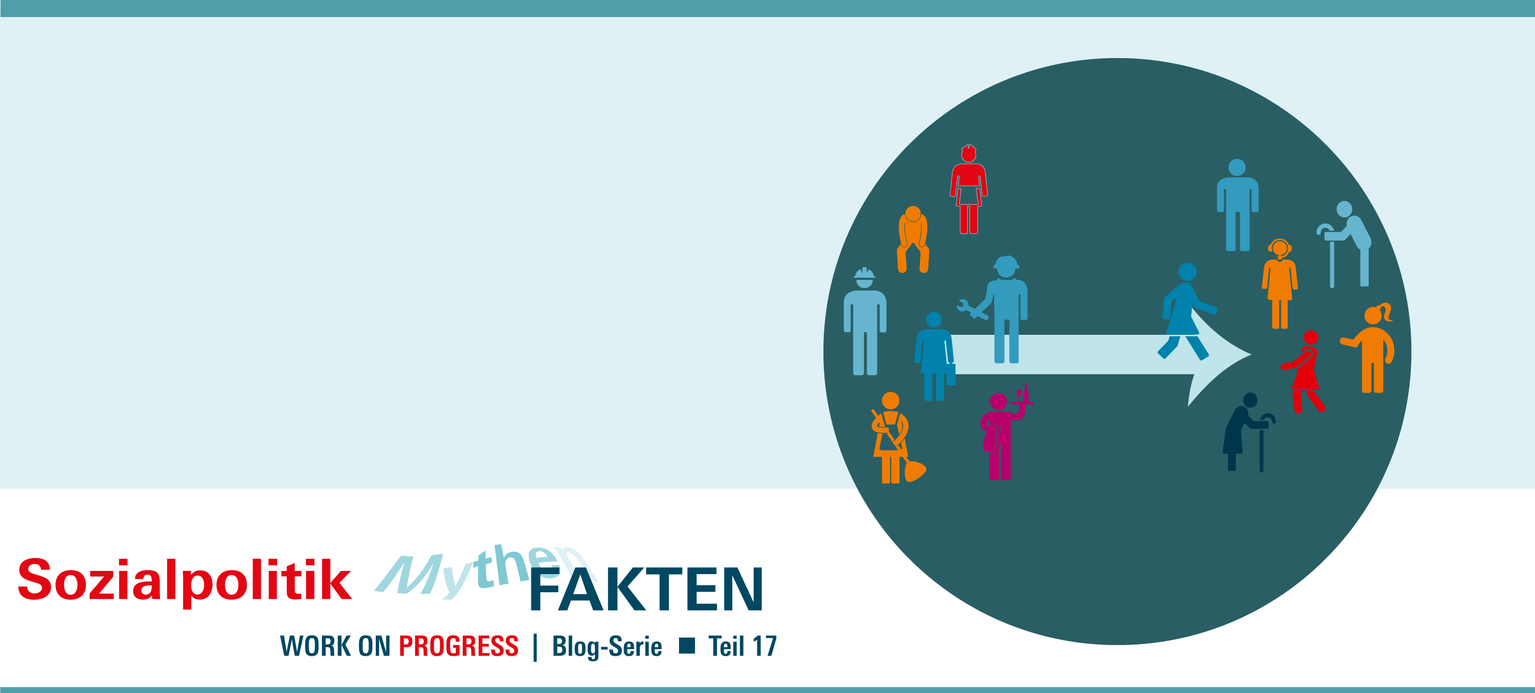
Quelle: WSI
Reinhold Thiede, 24.04.2025: Umlagefinanzierte Alterssicherung funktioniert – auch wenn die Bevölkerung altert
Steht die Rente angesichts der alternden Bevölkerung vor dem Kollaps? Nein. Die Rentenversicherung ist in ihrer Geschichte immer wieder mit der demografischen Herausforderung fertig geworden.
„Mit dem demografischen Wandel – immer mehr Rentnerinnen und Rentner stehen immer weniger Beitragszahlern gegenüber – ist das bisherige Finanzierungsmodell (der Rentenversicherung) nicht langfristig tragfähig“, so begründete der damalige Bundeswirtschaftsminister Lindner vor zwei Jahren seinen Vorschlag für die Einrichtung eines sog. „Generationenkapitals“ in der Alterssicherung (BMF 2023). Das von ihm genutzte Narrativ, bei einer zunehmenden Zahl älterer Menschen und gleichzeitigem Rückgang der Zahl der Jüngeren wäre die umlagefinanzierte Rentenversicherung nicht mehr finanzierbar, ist eine in Wissenschaft, Politik und Medien weit verbreitete Einschätzung. Dieses Narrativ ist auch keineswegs neu, sondern eine alte, aber immer wieder neu formulierte Erzählung.
Ein häufig benutztes Narrativ – aber auch eine „never fullfilled prophecy“
Die Erzählung von der Greisenrepublik ist nicht neu: Schon in den 1930er Jahre wurde – insbesondere in deutschnationalen und völkischen Kreisen – beklagt, dass die „Vergreisung“ des Volkes eine steigende Zahl von Rentnern und zurückgehende Beitragseingänge in der Rentenversicherung zur Folge haben. In einer 1932 herausgegebenen Schrift des deutsch-nationalen Reichstagsabgeordneten Gustav Hartz – nicht verwandt oder verschwägert mit dem späteren Namensgeber der sog. Hartz-Gesetze – heißt es beispielsweise: „In einer Reihe von Jahren sind nicht mehr genug junge beitragszahlende Menschen da, die in der Lage sind, die Summen aufzubringen, die zur Ernährung einer immer größer werdenden Zahl von Alten nötig werden.“ (Hartz 1932, S. 148). Gut 30 Jahre später, 1966, warnte in der noch jungen Bundesrepublik die Sozialenquete-Kommission wegen der „Zunahme des Zahlenverhältnisses von Alten und wirtschaftlich Aktiven“ vor einem „Rentenberg“, der nach 1975 große Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität der Altersversorgung habe (Bogs et al. 1966, S. 165 f.). Und Mitte der 1980er Jahre schrieb der SPIEGEL (1985) in einer Titelgeschichte unter der Überschrift Renten in Gefahr – Die Last wird zu groß: „Wer trägt die Last im Jahr 2000, wenn immer weniger Arbeitnehmer immer mehr Ruheständler ernähren müssen?“
Das Narrativ „Wenn die Zahl der Menschen im Rentenalter im Vergleich zu den Jüngeren steigt, bricht das umlagefinanzierte Rentensystem zusammen“ ist also in den vergangenen einhundert Jahren immer wieder bemüht worden. Und es ist auch zu konstatieren, dass die dabei zu Grunde gelegten Annahmen bzw. Prognosen zur Alterung der Bevölkerung im Grundsatz zutreffend waren: Der sogenannte Altenquotient, also das Zahlenverhältnis von älteren Menschen zur Bevölkerung im Erwerbsalter, ist tatsächlich deutlich angestiegen – in den späten 1930er Jahren ebenso wie in den 70er Jahren oder in dem Jahrzehnt nach dem Jahrtausendwechsel (Thiede 2023a, b). Allerdings hat das nie den vorhergesagten Kollaps der Rentenversicherung zur Folge gehabt. Dass die umlagefinanzierte Rente bei einer älter werdenden Bevölkerung unfinanzierbar würde, hat sich als eine „never fullfilled prophecy“ erwiesen (Thiede 2024).
Auswirkungen der Bevölkerungsalterung können kompensiert werden
Der wesentliche Grund dafür ist, dass die umlagefinanzierte Alterssicherung nicht nur von der Demografie, sondern auch von der Entwicklung vielfältiger anderer ökonomischer, rechtlicher und gesellschaftlicher Faktoren abhängt. Anders als bei realitätsfernen Modellbetrachtungen, die nur die zahlenmäßige Entwicklung von Renten- und Erwerbsgeneration berücksichtigt, können in der realen Welt diese Faktoren die Auswirkungen der demografischen Alterung kompensieren – und haben dies auch stets getan. Deshalb ist die umlagefinanzierte Rentenversicherung trotz des „Rentenberges“ Mitte der 1970er Jahre oder der stark steigenden demografischen Belastung um das Jahr 2000 eben nicht kollabiert, sondern die Situation der Rentnergeneration hat sich sogar permanent verbessert.
Ein wichtiger Faktor war dabei zweifellos eine positive ökonomische Entwicklung, die es ermöglichte, Zuwanderung in erheblichem Umfang in den Arbeitsmarkt zu integrieren und die zudem auch einen massiven Anstieg der Erwerbsbeteiligung (namentlich bei Frauen und älteren Arbeitnehmern) nach sich zog – und umgekehrt haben diese Gruppen sicher auch zum Wirtschaftswachstum beigetragen. Im Ergebnis stieg so die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten trotz der demografischen Alterung deutlich an. Im Hinblick auf den starken Anstieg der demografischen Belastung, der in dem zitierten SPIEGEL-Artikel für die Zeit um das Jahr 2000 vorausgesagt wurde, kam zudem auch den zwischenzeitlichen Rentenreformen sowie der strukturellen Erhöhung des Bundeszuschusses in den Jahren um die Jahrtausendwende erhebliche Bedeutung zu.
Der „Rentenberg“, vor dem die Sozial-Enquete Kommission Mitte der 1960er Jahre gewarnt hatte, wurde dagegen vor allem auch durch eine Maßnahme kompensiert, die heute bei vielen verpönt ist: Durch eine massive Anhebung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung. In dem kurzen Zeitraum von 1968 und 1973 wurde er von 14 auf 18 Prozent angehoben – also um mehr als ein Viertel! Die Befürchtungen vor gravierenden ökonomischen Auswirkungen, die heute gebetsmühlenhaft bei jeder Prognose auch eines sehr viel moderateren Beitragssatzanstiegs laut werden, waren seinerzeit offensichtlich zumindest nicht so nachdrücklich, dass sie diesen Weg zur Kompensation steigender demografischer Belastungen verhindert hätten.
Kompensation der Bevölkerungsalterung durch Beitragsanhebung: Eine realistische Option
Sicherlich sind Beitragssatzanhebungen nicht der einzige und vielleicht auch nicht der Königsweg zur Kompensation einer steigenden demografischen Belastung. Allerdings sind auch die in Politik und Wissenschaft diskutierten Alternativen, speziell die weitere Anhebung des Rentenalters und eine im Verhältnis zu den Löhnen langsamere Anhebung der Renten, nicht unumstritten. Deshalb erscheint es nicht gerechtfertigt, dass im gesellschaftlichen Diskurs höhere Beitragssätze zur Sicherstellung ausreichender Rentenzahlungen im demografischen Wandel kategorisch ausgeklammert oder als nicht akzeptabel abgelehnt werden. Denn da der nach den aktuellen Vorausberechnungen in den kommenden Jahrzehnten zu erwartende Anstieg des Altenquotienten nicht höher ausfallen dürfte als jener in den 1960er Jahren und sogar geringer als der um die Jahrtausendwende (Thiede 2023a, Abb. 3), gilt dies auch im Hinblick auf den erforderlichen Kompensationsbedarf. Dies zeigen z.B. auch Vorausberechnungen zur Beitragssatzentwicklung, wie sie etwa jüngst von Martin Werding, Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage (SVR) – und ganz sicher nicht verdächtig, die Auswirkungen des demografischen Wandels klein zu reden – gemeinsam mit Mitarbeitenden des SVR publiziert wurden (Werding et al. 2024). Ihre Simulationsrechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass im sog. Basisszenario (basierend auf den jeweils mittleren Annahmen der 15. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung zur Entwicklung von Geburtenzahlen, Lebenserwartung und Zuwanderung sowie dem geltenden Rentenrecht) der Beitragssatz der Rentenversicherung von heute 18,6 Prozent bis zum Jahr 2040 auf gut 21 Prozent ansteigt (ebd., S. 8). Weitere vierzig Jahre später, im Jahr 2080, kommen die Simulationsrechnungen von Werding u.a. dann auf einen Beitragssatz von 24 Prozent im Basisszenario (d.h. bei Beibehaltung des geltenden Rentenrechts).
Nun mag man unterschiedlich bewerten, ob ein Beitragssatzanstieg um ca. 2,5 Prozentpunkte in den nächsten 15 Jahren viel oder wenig ist; ob und ggf. in welchem Umfang er Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung hätte. Auf jeden Fall ist es aber ein moderaterer und sehr viel langsamerer Anstieg als die beschriebene massive Anhebung Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre. Und ein Beitragssatz von 21 Prozent im Jahr 2040 wäre auch im internationalen Vergleich nicht exorbitant hoch; er läge immerhin deutlich unter den Sätzen, die heute bereits in mehr als einem Dutzend europäischer Ländern Realität sind (OECD 2023, Tab. 8.1) und dort weder zu größeren ökonomischen Problemen noch zu einem Zusammenbruch der Rentenversicherung führen.
Und noch ein weiterer Aspekt spricht dafür, dass der angesichts der Bevölkerungsalterung erforderliche Beitragssatzanstieg nicht notwendigerweise massive ökonomische Verwerfungen nach sich ziehen muss. In Österreich liegt der Beitragssatz zur Rentenversicherung nämlich bereits seit Jahrzehnten bei 22,8 Prozent, ohne dass dies zu gravierenden ökonomischen Problemen geführt hätte. Im „Basisszenario“ der Berechnungen von Werding u.a. – also bei geltendem Rentenrecht – würde der Beitragssatz in Deutschland erst um das Jahr 2060 herum auf den Wert ansteigen, der in Österreich seit langem Realität ist (Werding et al. 2023, S. 8). Selbst bei einer unterstellten dauerhaften Stabilisierung des Rentenniveaus auf 48 Prozent – wie im nicht mehr realisierten „Rentenpaket II“ der früheren Bundesregierung vorgesehen – erreicht der Beitragssatz nach diesen Simulationsrechnungen erst Ende der 2040er Jahre die heutige Höhe des österreichischen Beitragssatzes von 22,8 Prozent (ebd., S. 19).
Das Rentenniveau ist die zentrale Maßzahl für die Entwicklung der Leistungen der Rentenversicherung. Es setzt eine Rente nach 45 Jahren Beitragszahlung bei Durchschnittsverdienst ins Verhältnis zum Durchschnittsverdienst. Rente und Durchschnittsverdienst werden nach Sozialabgaben, aber vor Steuern betrachtet (daher „Sicherungsniveau vor Steuern“). Ein stabiles Rentenniveau bedeutet, dass die Renten entsprechend der Löhne steigen, ein sinkendes Niveau bedeutet, dass sie hinter der Lohnentwicklung zurückbleiben. Nach geltendem Recht wird das Sicherungsniveau ab 2026 in der Tendenz weiter sinken. Ein direkter Schluss vom individuellen Einkommen auf eine individuelle Rente ist nicht möglich.
Auch wenn Ländervergleiche einzelner Variablen von Rentensystemen grundsätzlich wenig aussagekräftig sind: Vor dem Hintergrund der Erfahrungen in anderen Ländern scheint eine Anhebung des Beitragssatzes eine zumindest diskussionswürdige Option, um trotz der älter werdenden Bevölkerung die Renten bei Beibehaltung des geltenden Rentenrechts zu finanzieren. Einen Kollaps der umlagefinanzierten Alterssicherung wird es jedenfalls angesichts des bevorstehenden Anstiegs der demografischen Belastung ebenso wenig geben wie in den vergleichbaren Phasen in den 1970er Jahren oder im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends.
Literatur
Bogs, W./Achinger, H./Meinhold, H./Neundörfer, L./Schreiber, W. (1966): Soziale Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland. Bericht der Sozialenquête-Kommission, Bonn
Bundesministerium der Finanzen (BMF) (2023): Startschuss für das Generationenkapital [abgerufen am 20.3.2025]
DER SPIEGEL (1985): Renten in Gefahr – Die Last wird zu groß [abgerufen am 20.2.2025]
Hartz, G. (1932): Die national-soziale Revolution – Die Lösung der Arbeiterfrage, München
OECD (2023): Pensions at a Glance 2023
Thiede, R. (2023a): Die demographische Belastung steigt… aber weniger als in der Vergangenheit!, in: rvaktuell 2/2023
Thiede, R. (2023b): Betriebliche Altersversorgung, S. 544–549
Thiede, R. (2024): Demografischer Wandel und Rentenversicherung: Eine unendliche Geschichte, in: Sozialer Fortschritt, Heft 1/2024, S. 47–54
Werding, M./Ruschke, B./Schwarz, M. (2024): Alterungsschub und Rentenreform: Simulationen für GRV und Beamtenversorgung. Arbeitspapier 01/2024 des Sachverständigenrates für die Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Dieser Beitrag wurde auch im sozialpolitikblog des Deutschen Instituts für interdisziplinäre Sozialpolitikforschung veröffentlicht.
|
Der Blog stellt aktuelle Forschung und neue sozialpolitische Konzepte vor, diskutiert Herausforderungen der Sozialpolitik und analysiert tagespolitische Ereignisse. Neben themenspezifischen Beiträgen werden auch Gespräche mit Wissenschaftler*innen, Praktiker*innen und Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung sowie Rezensionen veröffentlicht. Damit will das DIFIS der interessierten Fachöffentlichkeit ein spannendes Diskussionsforum zur aktuellen Sozialpolitik und Sozialpolitikforschung bieten.
|
Zurück zum WSI-Blog Work on Progress
Die Beiträge der Serie
- Florian Blank/Jutta Schmitz-Kießler/Eike Windscheid-Profeta: Mythen der Sozialpolitik: Eine Blogserie (30.07.2024)
- Camille Logeay/Florian Blank: Das Generationenkapital – alle profitieren? (30.07.2024)
- Jennifer Eckhardt: Von wegen Hängematte: Zur Unzugänglichkeit von Sozialleistungen (01.08.2024)
- Dagmar Pattloch: Das Zugangsalter in die Rente der Deutschen Rentenversicherung Bund. Eine Richtigstellung (08.08.2024)
- Johannes Geyer: Die Grundrente: Was ist das eigentlich? (15.08.2024)
- Eileen Peters/Yvonne Lott: Die unbezahlte Doppelbelastung: Warum Frauen nicht noch mehr arbeiten können (22.08.2024)
- Jutta Schmitz-Kießler: Hartnäckig, aber falsch: Die Kritik an der Bürgergelderhöhung (30.08.2024)
- Eike Windscheid-Profeta: Jung, faul, wehleidig: Hat die „Gen Z“ den Generationenvertrag gekündigt? (04.09.2024)
- Ingo Schäfer: Die Wahrheit: Warum Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung richtig sind (27.09.2024)
- Nina Weimann-Sandig: Betreuungskrise: Warum mehr Stunden nicht helfen (04.10.2024)
- Andreas Jansen: Nein! Die Rentenangleichung ist nicht für alle Menschen in Ostdeutschland von Vorteil (29.11.2024)
- Eike Windscheid-Profeta: Krankheitsbedingte Fehlzeiten: Zwischen Bettkanten und dünnen Personaldecken (13.12.2024)
- Johannes Steffen: Die Bürgergeld-Reform von 2023 – Quelle allen Übels? (04.02.2025)
- Michaela Evans-Borchers/Christoph Bräutigam: Zukunft der Pflege: „Die“ Pflege gibt es nicht! (07.02.2025)
- Eike Windscheid-Profeta: Arbeitsvolumen in Deutschland: (Wieder) mehr und länger arbeiten für Wohlstand und Wohlfahrt? (07.04.2025)
- Magnus Brosig: Faire Haltelinie: Warum ein dauerhaft stabiles Rentenniveau sinnvoll und gerecht ist (14.04.2025)
- Reinhold Thiede: Umlagefinanzierte Alterssicherung funktioniert – auch wenn die Bevölkerung altert (24.04.2025)
weitere Beiträge in Vorbereitung
Autor
Dr. Reinhold Thiede war von 2010 bis 2023 Leiter des Geschäftsbereichs „Forschung und Entwicklung“ der Deutschen Rentenversicherung Bund und hat sich in seiner Forschungsarbeit intensiv mit der Entwicklung von sozialer Sicherung und Altersvorsorge befasst.